Pastoralmesse in G-Dur, op.24
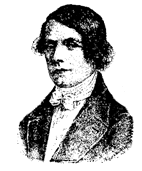 Karl
Kempter wurde am 17. Januar 1819 in Limbach in der Nähe von Günzburg geboren.
Der Ort liegt heute im bayerischen Schwaben neben der Autobahn A8 etwa auf
halber Strecke zwischen Augsburg und Ulm. Mit 20 Jahren war er bereits
Domorganist in Augsburg, später wurde er auch Domkapellmeister. Er war - wie
es die Stellung mit sich brachte - Schöpfer zahlreicher kirchenmusikalischer
Werke. Andere Kompositionen, wie z.B. eine "Hymne an König Ludwig" oder
der "Festmarsch für Klavier zu vier Händen" op. 129, sind in seinem
Schaffen eher die Ausnahme. Kempter verstarb am 11. März 1871 im Alter von nur
52 Jahren.
Karl
Kempter wurde am 17. Januar 1819 in Limbach in der Nähe von Günzburg geboren.
Der Ort liegt heute im bayerischen Schwaben neben der Autobahn A8 etwa auf
halber Strecke zwischen Augsburg und Ulm. Mit 20 Jahren war er bereits
Domorganist in Augsburg, später wurde er auch Domkapellmeister. Er war - wie
es die Stellung mit sich brachte - Schöpfer zahlreicher kirchenmusikalischer
Werke. Andere Kompositionen, wie z.B. eine "Hymne an König Ludwig" oder
der "Festmarsch für Klavier zu vier Händen" op. 129, sind in seinem
Schaffen eher die Ausnahme. Kempter verstarb am 11. März 1871 im Alter von nur
52 Jahren.
Seine Position als Domorganist war sicherlich eine ganz andere, als die seines Zeitgenossen Ignaz Reimann, der "lediglich" das Amt eines Dorfkantors bekleidete, nichtsdestoweniger berücksichtigt ein großer Teil auch Kempters Schaffen die Leistungsfähigkeit der Laienchöre, die seit der Säkularisation 1803 die Hauptträger kirchenmusikalischer Aufführungspraxis geworden waren und sind. Viele seiner Messen und anderer sakraler Werke sind so angelegt, daß sie je nach den musikalischen Möglichkeiten der Gemeinde (heute ist wohl eher das Kirchenmusikbudget ausschlaggebend) sowohl in kleinster Besetzung in Singstimmen und Begleitung oder auch außerordentlich festlich mit vollem Chor und Orchester aufgeführt werden können. Viele der geistlichen Kompositionen Kempters tragen im Untertitel Zusätze, die Hinweise auf notwendige Besetzungsstärke und Anspruch geben, wie die Lateinische Messe in G op. 15 "zum Gebrauche gut besetzter Land- und kleinerer Stadt-Chöre". Manche sind in der Minimalbestztung sogar nur zwei- oder gar einstimmig, um wirklich auch in der kleinsten Gemeinde eine angemessene musikalische Gestaltung der Heiligen Messe zu ermöglichen. Beispiele hierfür sind die im Cyclus katholischer Kirchenmusik für kleinere Landchöre erschienene Sonntagsvesper in G und die Lateinische Messe in C op. 61, beide für "eine Singstimme mit Orgel obligat, dann Alt, Baß, 2 Violinen, 2 Hörner ad libitum" oder die Musica Sacra bei dem vor- und nachmittägigen Gottesdienste in den katholischen Kirchen; zum Gebrauche der kleinen Stadt- und Land-Chöre kurz und leicht componirt; mit Sopran, Alt, Baß, 2 Violinen und Partiturbaß oder Violon obligat; Tenor, Viola, Flöte, 2 Clarinetten, 2 Hörner, 2 Trompeten und Pauken nicht obligat; oder auch nur mit den Singstimmen und ausgesetzter Orgel&qout;. Fehlende Männer im allgemeinen und gute Tenöre im besonderen waren offensichtlich wohl schon damals ein Problem. Das kann man auch dem Zusatz zu den Deutschen Meßgesängen op. 30 entnehmen, die für 1 Singstimme mit Orgelbegleitung gesetzt sind "und beliebigem Gebrauche von Alt, Tenor & Baßstimme". Ingesamt war die Förderung des musikalischen Nachwuchses ein Hauptanliegen Kempters, wie die 112 kurze und leichte Orgelstücke für angehende Organisten im 2-, 3- und 4-stimmigen Satz in allen Dur- und Moll-Tonarten op 66 belegen. Ansonsten hatte Kempter eine Vorliebe fürs "Pastorale". 1854 erschienen ein Pastoral-Offertorium und ein Pastoral-Graduale, beide übrigens in der Besetzung der Pastoralmesse op. 24.
Die Pastoralmesse op. 24 erklang erstmals in der Christmette am Heiligen Abend 1851 im Dom von Augsburg. Sie ist wie der Großteil der übrigen Werke Kempters bei Anton Böhm in Augsburg verlegt worden. Während noch die Ausgabe von 1901 schlicht als "Pastoralmesse" tituliert ist, trägt bereits die Ausgabe von 1949 die Überschrift "Berühmte Pastoralmesse", ein Zusatz, der wohl für sich spricht, was die Verbreitung dieser Messe anbelangt. Auch Eugen Jochum hat sie aufgeführt: Im Archiv der Bayerische Staatsbibliothek befindet sich eine Dirigierpartitur mit handschriftlichen Eintragungen dieses Dirigenten. Von Joseph Dantonello ist auch eine Bearbeitung für vierstimmigen Männerchor erschienen.
Die Begleitung besteht aus obligatem Streichquartett (2 Violinen, Viola, Violon) und Orgel, sowie Violoncello, Flöte, zwei Klarinetten, zwei Hörner, zwei Trompeten und Pauken ad libitum. Viele der geistlichen Kompositionen Kempters sind mit dieser Instrumentierung ausgesetzt, was die bereits oben erwähnte Flexibilität in der Aufführungspraxis ermöglicht. Bei Verwendung von Bläsern und Pauken erhalten alle diese Musikstücke einen unbestreitbar festlichen Charakter.
Im süddeutschen Raum hat die Pastoralmesse deswegen und wegen ihrer "hirtenmelodiemäßigen" (eben "pastoralen" von lat. pastor, Hirt) Zitate als Weihnachtsmesse, besonders zur Aufführung während der Christmette, weiteste Verbreitung gefunden. Besonders deutlich tritt dieser pastorale Charakter zu Beginn des Credos hervor, das mit einem melodischen Motiv über leeren Quinten in den Streichern beginnt. Die Verwendung der leeren Quinten war seit dem 18. Jahrhundert mit seiner höfischen Vorliebe für das "Schäferleben" ein gebräuchliches stilistisches Mittel, um in der Musik das "Landleben" (was immer man auch darunter verstand) darzustellen: Diese leeren Quinten sollen an die durchgängig erklingenden und in Quinten und gelegentlich zusätzlich in Oktaven gestimmten Borduntöne von Sackpfeife (Dudelsack) und Drehleier erinnern. Die beiden letzteren waren überall in Europa als Volksmusikinstrumente bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts von größter Bedeutung. Ansonsten zeichnet sich die Pastoralmesse op. 24 durch eine eingängige, um nicht zu sagen "liebliche" Melodik aus, eine Eigenschaft, die im ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhundert ebenfalls mit "Hirtenmusik" assoziiert wurde - man denke nur an Beethovens "Pastorale" oder Haydns Oratorium "Die Jahreszeiten". Nichtsdestoweniger ist diese Messe erkennbar ein Werk der deutschen Hochromantik. Die Ansprüche an die Aufführenden sind allerdings insofern mäßig, als die Harmonik in allen Stimmen etablierten Hörgewohnheiten folgt und kaum schwer singbare "schräge" Akkorde oder Intervalle enthält, obwohl sie sich im Sopran des öfteren bis zum zweigestrichenen a versteigt. Diese leichte Singbarkeit hat wohl zusammen mit dem festlichen Charakter zur weiten Verbreitung dieser Messe beigetragen.